ca. 3000 v. Christus: Das älteste Göppinger
Schmuckstück
Bei Grabarbeiten des
"Nationalen Freiwilligen Arbeitsdienstes" an der
Flugplatzbaustelle auf der "Großen Viehweide" fanden Arbeiter
1933 einen flachen, ca. 8 cm langen, ovalen Kieselstein. Der
Stein war durchbohrt. Da das Loch doppelkonisch ausgeformt
ist, kann man davon ausgehen, dass hier planvoll mit einfacher
Bohrtechnik ein Loch zum Durchschleifen eines Bändels
gefertigt wurde.
Lange war die
zeitliche Einordnung ungewiss. Der Göppinger Archäologe Dr.
Rainer Schreg weist durch Vergleich mit ähnlichen Funden in
Süddeutschland nach, dass der Stein am Ende der Steinzeit im
sog. Endneolithikum als Anhänger gefertigt wurde. Vor allem
von einigen Uferrandsiedlungen am Bodensee und aus der Schweiz
kennt man ähnliche Kieselanhänger. Die großen, einfach
gearbeiteten Anhänger lösten zierliche Schmuckformen aus
röhrenförmigen Kalksteinperlen ab, wie man sie in einer
spät-jungsteinzeitlichen Fundstelle bei Uhingen – zusammen mit
feinen Steinbohrern – gefunden hat. Hier ist wohl nicht nur
ein Modetrend zu beobachten, wahrscheinlich kam den "neuen"
Stein-Anhängern kultische oder Unheil abwehrende Bedeutung zu.
Das älteste Göppinger Schmuckstück ist im Naturkundlichen
Museum in Jebenhausen ausgestellt.

Kieselanhänger vom Göppinger Flugplatz
um 500 v. Christus: Der "Kelten-Fürst" von Göppingen?
Aus der keltischen Späthallstattzeit sind aus
Baden-Württemberg einige reich mit Beigaben bestückte
Fürstengräber bekannt, etwa der Grabhügel des Keltenfürsten
von Hochdorf. Die Fürstengräber liegen in der Nähe zentraler
Siedlungen, wie etwa bei Ludwigsburg ergraben oder die
Heuneburg bei Hundersingen. In Höhenlagen errichteten die
Kelten in dieser Zeit Herrensitze, so auf dem Hohenstaufen, wo
zahlreiche Keramikfunde eine Siedlung belegen. Im Umfeld des
Hohenstaufens liegen einige Grabhügelfelder, das größte im
Waldgebiet des Oberholzes nördlich von Göppingen. 33
Hügelgräber mit einem Durchmesser von 9 bis 38 Meter und einer
Höhe von bis zu 2 Meter lassen sich dort heute noch
erkennen.
In den aus Erde und Steinen errichteten Gräbern bestatteten
die Kelten ihre Toten und statteten sie mit Beigaben aus.
Beigaben und Größe des Hügels sind abhängig vom sozialen
Status des Toten. Die Hügel im Oberholz zeigen Spuren von
früheren (Raub-) Grabungen, alle damals gemachten Funde sind
verschollen. Etwas abgesetzt von der Grabhügelgruppe findet
sich ein riesiger Einzelhügel, der aufgrund seiner Größe als
Fürstengrab bezeichnet werden kann. Reste eines Wagens – ein
prachtvolles Exemplar ist in Hochdorf gefunden worden – deuten
darauf hin. Doch von dem bereits vollständig "durchgegrabenen"
Hügel hat sich kein einziges Fundstück erhalten, spärliche
Kenntnisse haben wir nur durch zeitgenössische Berichte.

Grabhügel im Oberholf, fotografiert von Walter
Lang.
um 150 n. Chr.: Der römische Gutshof bei Oberhofen
Als zu Beginn der
1980er Jahre der Innenraum der Oberhofenkirche grundlegend
renoviert wurde und das Gotteshaus eine Fußbodenheizung bekam,
waren damit archäologische Nachforschungen verbunden. Unter
dem Boden des Kirchenschiffs wurden als älteste
Siedlungsspuren einige Mauerzüge eines römischen Gutshofs
freigelegt, die aber keinen vollständigen Gebäudegrundriss
ergaben. Eindeutig konnte der Zugang zu einem Kellerraum und
Ansätze von Lichtschächten für diesen Keller bestimmt
werden.
Eine solche
Gutsanlage nannten die Römer "villa rustica". Sie umfasste ein
Hauptgebäude und mehrere Gesinde- und Wirtschaftsgebäude, in
denen sich Handwerksbetriebe befanden.
Zivile Siedlungen
konnten an der Fils erst entstehen, nachdem der Limes in der
Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. auf die Linie Aalen – Lorch
– Welzheim vorverlegt worden war. In dieser Zeit muss auch der
Gutshof bei Oberhofen errichtet worden sein. Um 260 wurde er
verlassen, als die Römer unter dem Druck der Alamannen ihre
rechtsrheinischen Besitzungen aufgaben.

Ein
besonderer Fund aus der Schicht des römischen Gutshofs ist ein
Siegelring aus Bronze mit eingesetzter Lapislazuli-Gemme mit
eingeschnittener Hirtenszene.
um 600 n. Christus: Das "Outfit" einer Göppingerin vor
1400 Jahren
Ein 12 bis 13 Jahre
altes Mädchen, nennen wir sie Ida, geht an einem Sonntag vor
1400 Jahren am Ufer der Fils entlang. Sie trägt eine knielange
Tunika, darüber einen Umhang, der mit einer goldenen
Scheibenfibel, einer Art Brosche, zusammengehalten wird. Ihr
Haar hat sie mit einer bronzenen Haarnadel hochgesteckt. Um
den Hals trägt Ida eine Perlenkette aus bunten Glasperlen. Die
wollenen Strümpfe sind mit Lederriemen und bronzenen Schnallen
oberhalb der Waden festgemacht. Die Füße stecken in ledernen
Schuhen. Außergewöhnlich sind einige Gegenstände, die an ihrem
Gürtel hängen. Neben einem kleinen Messer sticht eine
kreisrunde, bronzene Scheibe, die von einem beinernen Ring
eingefasst ist, ins Auge. Diese Zierscheibe hat magischen
Charakter. An einem Lederbändel hängt noch das Gehäuse einer
Tigerschnecke. Dieses Importstück vom Roten Meer ist wohl ein
Fruchtbarkeitssymbol. Das sog. Gürtelgehänge ist typisch für
eine Alamannin, es zeigt auch den sozialen Status der
Trägerin.
Und woher kennen wir
Idas Tracht. Sie wurde 1864 in einem Grabfeld beim
Christophsbad ausgegraben. Der Ausgräber Dr. Hölder konnte
Alter und Geschlecht am erhaltenen Schädel
feststellen.

So könnte
Ida ausgesehen haben. Comicfigur von Susanne Mück,
Tübingen.
875: Urkundliche Ersterwähnung Faurndaus
Unter den Göppinger
Stadtbezirken ist der Ortsname Faurndau am frühesten in
schriftlicher Form überliefert. Erstmals erwähnt ist der Name
in einer Urkunde vom 11. August 875. Mit diesem Dokument
verlieh König Ludwig der Deutsche, der Enkel Karls des Großen,
seinem Diakon Liutbrand für seine Dienste das Klösterchen
"Furentouua" im Herzogtum Alamannien. In diesem Zusammenhang
übergab der König dazu gehörige Liegenschaften, bestehend aus
Wiesen, Wäldern, Weiden, Weinbergen und Wasserläufen, sowie
Leibeigene. Bei der Erwähnung von Weinbergen in Faurndau
handelt es sich im Übrigen um den ältesten schriftlichen
Hinweis für Weinbau im Filstal. Diese Urkunde muss im
Zusammenhang mit zwei anderen Schriftstücken betrachtet
werden. Dabei handelt es sich zum einen um eine am selben Tag
ausgestellte weitere Urkunde, in der die Kapelle in Brenz an
der Brenz dem Klösterchen Faurndau als Zugehör übereignet
wurde. Zum anderen handelt es sich um ein auf 11. Februar 888
datiertes Dokument, in dem König Arnulf das Klösterchen
Faurndau einschließlich der damit verbundenen Kapelle in Brenz
dem erwähnten Diakon Liutbrand schenkte. Mit der Aufnahme
Liutbrands in das Kloster St. Gallen ging die einstige
Königsabtei Faurndau in den Besitz dieses mächtigen Klosters
über. Der Ortsname Faurndau bedeutet "Siedlung an einem
zerstörenden Fluss" und ist sicherlich auf die oft
auftretenden Hochwässer der Fils zurückzuführen.
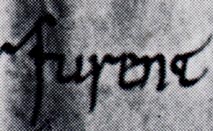
Der
Namenszug "Furentouua" in der Urkunde von 875
Im Mittelalter: Edler Tropfen aus Göppingen?
Früher war Weinbau
auch in Gegenden verbreitet, in denen heute kein edler Tropfen
mehr angebaut wird, sei es aus Gründen der Rentabilität, des
Aufwandes oder vielleicht auch des Geschmackes.
Der erste Beleg für
Weinbau in Göppingen stammt aus dem Jahre 875. In einer
Urkunde verlieh König Ludwig der Deutsche seinem Diakon
Liutbrand das Kloster Faurndau mit allen Liegenschaften. Dazu
zählten laut Urkunde neben Wiesen, Weiden, Wäldern und
Wasserläufen auch Weinberge.
Auch Flurnamen wie
"Am Weingärtenberg", "unter den Weingärten", "hinter der
Kelter" oder "Kelterkopf", wie man sie zum Beispiel am Eichert
finden kann, deuten auf Weinbau hin. Sicher haben die
Göppinger schon im Mittelalter dort Reben angebaut. Im 18.
Jahrhundert war der Weinbau in Göppingen endgültig aufgegeben
worden. Ein Messprotokoll von 1718 nennt den Grund: "Von den
Weinbergen ist allerdings nicht der Mühe wert, etwas zu
gedenken, vorderist seind auf der ganzen Markung weiter nicht
als 16 Morgen, welche erst bei ettlich und 20 Jahren zu
Weingärt gemacht worden und vormalen Gärten gewesen seind und
im Ertrag so schlecht und elend beschaffen, dass alle Weingärt
ein Jahr in das andere nicht wohl 4 Eimer
gewehren."

Das
Filstalpanorama von 1534/35 zeigt einen Weinberg zwischen
Göppingen und Eislingen.
1070: Bau der Burg Hohenstaufen
Ein genaues Baudatum
der Burg ist nicht überliefert. Freilich erlaubt die
quellenkritische Untersuchung der mittelalterlichen
Aufzeichnungen des Otto von Freising den Rückschluss, dass die
Burg um 1070 entstanden ist. Als Erbauer gilt der Großvater
Barbarossas, Friedrich I., der erste Herzog von Schwaben aus
den Reihen der Staufer. Nach neuen Forschungen ist davon
auszugehen, dass es sich bei dieser Maßnahme um keinen Neubau
handelte. Vielmehr spricht vieles dafür, dass Friedrich noch
als Graf, wenige Jahre vor seiner Herzogserhebung 1079, eine
bereits bestehende einfachere Befestigung auf dem Hohenstaufen
umgestaltet hatte. Die Wissenschaft sieht die Herzogserhebung
des Staufers im Zusammenhang mit dessen enger politischer und
privater Verbindung zum salischen Kaiserhaus. Friedrich hatte
sich in der schweren politischen Krise, als der Salierkaiser
Heinrich IV. seinen "Gang nach Canossa" im Winter 1076/77
antrat, als konsequenter und treuer Parteigänger bewährt.
Durch seine Heirat mit Agnes von Waiblingen wurde er
Schwiegersohn Kaiser Heinrichs IV. und leitete damit den
beispiellosen Aufstieg der Staufer zu einem der wichtigsten
Machtfaktoren im Europa des 12. und des 13. Jahrhunderts ein.
Am Rande sei noch darauf verwiesen, dass Agnes von Waiblingen
nach dem Tod Herzog Friedrichs I. in zweiter Ehe den
Babenberger Markgraf Leopold III. von Österreich ehelichte.
Dieser Sachverhalt begründete eine historische Brücke für die
Städtepartnerschaft zwischen Göppingen und Klosterneuburg bei
Wien.

Modell der Burg Hohenstaufen von Werner
Lipp
12. Jahrhundert: Die älteste mittelalterliche
Inschrift
Von der ehemaligen
Grabplatte, die in der südwestlichen Ecke des Langhauses der
Stiftskirche Faurndau gefunden wurde, ist nur noch ein
Bruchstück erhalten. Auf der nahezu dreieckigen Platte sind
zwischen zwei im Relief erhabenen Kreuzen auf drei Zeilen
verteilt die Worte "HIC IA/CET / CVNEMVNT") eingeschlagen.
Darunter schließt sich ein weiteres Kreuz an.
"Hier ruht Cunemunt"
wird der Nachwelt berichtet. Wer war die im 12. Jahrhundert
lebende Person – in diesen Zeitraum ist diese Grabplatte zu
datieren. Kreisarchivar Walter Ziegler hat als denkbare
Zuschreibung auf den 1158 und 1161 urkundliche erwähnten
Cunimunt verwiesen, der zu der Familie gehört, die nach dem
Untergang der Staufer die Vogtei über das Faurndauer Stift
hatte.

Die
Grabplatte mit der ältesten mittelalterlichen Inschrift auf
dem heutigen Göppinger Stadtgebiet ist im Museum im Storchen
ausgestellt.
1143: Urkundliche Ersterwähnung Holzheims
In einer im Herbst
1143 ausgefertigten Pergamenturkunde taucht erstmals der
Ortsname des heutigen Göppinger Stadtbezirks Holzheim auf.
Inhalt dieses Dokuments ist die Stiftung des Klosters Anhausen
an der Brenz, das als wirtschaftliche Existenzgrundlage mit
Begüterungen der näheren und weiteren Umgebung ausgestattet
wurde. Zu diesen übergebenen Besitzrechten gehörten auch Güter
in Holzheim und in "Matheshowe". Ob es sich bei dem
letztgenannten Ortsnamen um das unter dem Hohenstaufen
gelegene Maitis handelt, ist in der Forschung
umstritten.
Dieser Urkunde voraus
ging der Plan, in Langenau ein Reformkloster in der Tradition
von Hirsau und Cluny anzulegen, das wegen der mangelhaften
Eignung des Platzes im Jahr 1125 nach Anhausen verlegt wurde.
Gestiftet wurde diese Mönchsniederlassung von den Adligen
Manegold, Adalbert und Ulrich und Walther, die von namhaften
Forschern als Mitglieder einer staufischen Seitenlinie
betrachtet werden. Der Hinweis auf Holzheim ist damit ein
wertvolles lokalgeschichtliches Indiz für Begüterungen des
staufischen Hauses im Göppinger Raum.
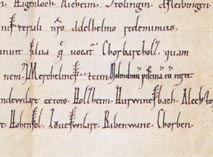
Der
Ortsname Holzheim ist in einer Urkunde von überregionalem Rang
erstmals erwähnt
1154: "Apud Geppingin"
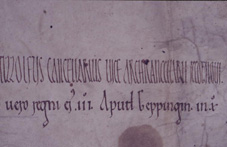
Im
Jahr 1154 war Friedrich Barbarossa zwischen dem 3. und 17. Mai
auf dem Weg von Worms über Ulm nach Batzenhofen bei Augsburg.
Bei dieser Reise durchs Filstal wurde "Apud Geppingin" (bei
Göppingen) eine Urkunde ausgefertigt, in der dem Kloster Lorch
Vergünstigungen bestätigt werden – beispielsweise die Wahl des
Vogts aus staufischem Hause –, die der Stauferkönig Konrad
III. verliehen hatte. Heute wird diese Barbarossa-Urkunde im
Stiftsarchiv St. Paul im Lavanttal in Kärnten aufbewahrt,
wohin sie über das Kloster St. Blasien im Schwarzwald zu
Beginn des 19. Jahrhunderts gelangte. Für den Aufenthalt
Barbarossas in unserer Region gibt es weitere Belege: Am 25.
Mai 1181 stellte er eine Urkunde auf der Stammburg der
Familie, "in castro staufen" aus und 1188 nahm er mit seinen
Söhnen an der Altarweihe der Klosterkirche Adelberg teil. Ein
Jahr später brach der Stauferkaiser zum Kreuzzug auf, bei dem
er das Heilige Land nicht mehr erreichte und am 10. Juni 1190
im Fluss Saleph (Göksu) in der Türkei
ertrank.
1181: Kaiser Barbarossa besucht die Stammburg seiner
Familie
Vielleicht stattete
Friedrich I. Barbarossa der Stammburg seiner Familie auch
einen Besuch ab, als er sich 1154 in oder bei Göppingen
aufhielt und 1188 an der Weihe des Hochaltars der
Klosterkirche Adelberg teilnahm. Ganz sicher überliefert ist
jedoch der Aufenthalt des Kaisers am 11. Mai 1181 auf dem Berg
Hohenstaufen. An diesem Tag stellte der Herrscher "in castro
Stoufen", also in der Burg Staufen, eine für das Kloster
Adelberg wichtige Urkunde aus. In diesem heute im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrten Rechtsdokument wird vom
Kaiser bestätigt, dass der jeweilige Herr von Staufen stets
auch der Vogt des Prämonstratenserklosters Adelberg sein soll.
Damit wurde dem noch jungen, 1178 von Barbarossas Vetter
Volknand von Staufen gegründeten Schurwaldkloster ein
besonderes Schutzprivileg gegeben.
In der Urkunde von
1181 heißt die Burg noch Staufen. Erst im 14. Jahrhundert
setzte sich die heute gebräuchliche Bezeichnung Hohenstaufen
für Berg und Burg durch. Zur Unterscheidung dazu nannte man
das Dorf damals Staufen.

Siegel
und Monogramm des Kaisers auf der Urkunde von 1181.
1206: Urkundliche Ersterwähnung Jebenhausens
Das älteste
schriftliche Dokument, in dem der Ortsname Jebenhausen erwähnt
wird, ist eine Pergamenturkunde aus dem Jahre 1206. In diesem
Schriftstück verzichten die Adligen Albert von Ravenstein und
Bruning von Staufen auf eine Reihe von Besitztümern zu Gunsten
des Klosters Adelberg. Zu diesen Gütern gehörten auch
Besitzrechte in Jebenhausen und eine Adelshof in Göppingen,
auf dessen Areal 1514 das Adelberger Kornhaus, die heutige
Stadtbibliothek, errichtet wurde. Mit den Edelfreien von
Ravenstein begegnet uns in dieser Urkunde eine Familie, die
zur Prominenz des süddeutschen Raumes im 13. Jahrhundert
gehörte. Aus den Reihen der Ravensteiner gingen u. a. ein
Augsburger Domherr und ein Bischof von Trient hervor. Mit
Agnes von Ravenstein, die mit Schenk Walter I. von Limpurg,
einem engen Ratgeber des Stauferkönigs Konrad IV. verheiratet
war, starb die Familie im Mannesstamm aus.

Ansicht
der abgegangenen Burg Ravenstein bei Steinenkirch
um 1220: Bau der Faurndauer Stiftskirche
Mit der Faurndauer
Stiftskirche befindet sich auf dem Boden Göppingens eines der
bedeutendsten spätromanischen Gotteshäuser Süddeutschlands.
Mit Fug und Recht wird die Kirche Kunstgeschichte des
Mittelalters in einem Atemzug mit berühmten Kirchenbauten wie
der Johanniskirche in Schwäbisch Gmünd, der Walterichskapelle
bei Murrhardt und der mit Faurndau in der Phase um das Jahr
875 eng verbundenen Kirche in Brenz an der Brenz genannt. Von
der bauhistorischen Forschung wird die Vollendung des heutigen
Faurndauer Kirchenbaus in die Zeit um 1220 datiert. Dem
Gotteshaus gingen an dieser Stelle offensichtlich einige
Vorgängerkirchen voraus. In deren Reihe gehört sicher auch das
bereits 875 erstmals schriftlich erwähnte "Klösterchen
Faurndau", das in der Folgezeit Besitz des Klosters St. Gallen
war.
Entsprechend der
Zeitströmung dürfte das Kloster Faurndau im frühen 12.
Jahrhundert in ein Chorherrenstift umgewandelt worden sein.
Diese Maßnahme wurde mit Berta von Boll, der Tochter des
Stauferherzogs Friedrich I. von Schwaben, in Verbindung
gebracht. Die Forschung plädiert bei der Suche nach dem
Bauherren der wohl ab 1200 als dreischiffige Basilika erbauten
Faurndauer Stiftskirche ebenfalls auf das Umfeld der Staufer.
Am Kirchenbau fallen der reichhaltige figürliche Schmuck an
Apsis, Chor und Ostgiebel auf. Im Kirchenraum sind die
wertvoll gearbeiteten Kapitelle und die in die Zeit um 1300
datierten Wandmalereien hervorzuheben. Durch eine grundlegende
Renovierung in den Jahren 1956 bis 1959 konnte der
ursprüngliche romanische Raumeindruck wiederhergestellt
werden.

Ansicht
der Faurndauer Stiftskirche nach einer Federzeichnung von Max
Bach (um 1880)
1260: Urkundliche Ersterwähnung Bartenbachs
In einer im Jahr 1260
ausgestellten Pergamenturkunde wird Bartenbach erstmals
schriftlich erwähnt. In dem Dokument bezeugt der Reichsschenke
Walter II. von Limpurg, dass der Hof des Klosters Lorch in
Bartenbach schon lange Zeit unter seiner Vogtei, also unter
seinem Schutz, steht. Fünf Jahre später verzichtet der Schenke
völlig überraschend auf dieses Recht und die damit verbundenen
Einkünfte. Dieser auf den ersten Blick merkwürdig anmutende
Vorgang wirft ein Schlaglicht darauf, nach welchen Spielregeln
im Mittelalter Konflikte ausgetragen und bereinigt
wurden.
Wie viele andere
weltliche Herren, die als Schutzvögte von geistlichen
Einrichtungen eingesetzt waren, missbrauchte auch Walter II.
von Limpurg sein Vogtrecht in der politisch unruhigen Phase
des Untergangs der staufischen Herrschaft: Walter II.
bereicherte sich auf Kosten der ihm anvertrauten Klöster Lorch
und Comburg bei Schwäbisch Hall. Vor dem Hintergrund, dass ihm
und anderen Schädigern kirchlicher Rechte von Papst Clemens
IV. mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht wurden,
verzichtete Reichsschenk Walter als Zeichen der
Wiedergutmachung auf seine Rechte in Bartenbach. Im Filstal
tritt Walter II. ein weiteres Mal 1274 urkundlich in
Erscheinung. Damals verpfändete er sein Lehen "Wäscherburg",
auf dem bis dahin sein Vertreter Conrad von Staufen, genannt
der Wascher, saß, an seinen Schwiegersohn Ulrich von
Rechberg.
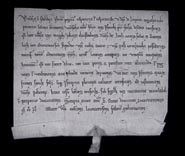
Die
Urkunde aus dem Jahr 1260, in der Bartenbach zum ersten Mal
genannt wird.
um 1300: Das Gießgefäß aus der Faurndauer Kirche
Als 1953 in der
spätromanischen Stiftskirche Faurndau Arbeiten für den Einbau
einer Heizungsanlage vorgenommen wurden, entdeckte man unter
dem Fußboden Tonscherben, die zu einer Tiergestalt gehörten.
Ein Bruchstück, das aus einer länglichen Ausgussröhre mit
Griff und Einfüllöffnung bestand, führte zur richtigen
Bestimmung: Es handelte sich um Scherben eines
Wassergießgefäßes, eines sog. Aquamanile. Aus den
vorgefundenen Tonscherben ließ sich die ursprüngliche Form des
Gießgefäßes gut nachvollziehen, so dass man sich später zu
einer rekonstruierenden Ergänzung entschlossen hat.
Die unglasierten
Tonscherben weisen durch ihren gelblichen Farbton und dem
Dekor aus sich kreuzenden roten Strichen auf die Herstellung
des Gießgefäßes in Buoch im Remstal hin. Dort wurde vom späten
12. Jahrhundert bis um 1400 mit roter Bemalung verziertes
Geschirr hergestellt, das im ganzen nordwürttembergischen Raum
als Tafelgeschirr Verwendung fand.
Nachdem das
Faurndauer Aquamanile in einem Gotteshaus gefunden wurde,
diente es im Mittelalter dort zur Handwaschung. Während der
Messe benötigte der Priester ein Wassergeschirr auf dem Altar,
um die Finger und die Hand zu reinigen, mit der er die heilige
Hostie berührte. Im weltlichen Bereich reihte sich das
Händewaschen in die vielfältigen höfischen Tischsitten des
Mittelalters ein. Edelknaben schütteten vor dem Essen den
hohen Gästen Wasser aus einem Gießgefäß in Tiergestalt über
die Hände, das sie in einer darunter gehaltenen Schüssel
wieder auffingen. So konnten die Gäste das Essen mit sauberen
Händen anfassen und zum Mund führen, denn die Gabel bzw. unser
Besteck war zu jener Zeit noch nicht in Gebrauch.

Das
Aquamanile aus der Stiftskirche von Faurndau ist als Leihgabe
der Kirchengemeinde im Museum im Storchen zu bewundern. Es
stammt aus der Zeit um 1300.
14. Jahrhundert: Erster Hinweis auf das Wappen mit der
Hirschstange
Das bis heute
verbindliche Göppinger Stadtwappen wird in der Fachsprache der
Heraldik wie folgt beschrieben: Unter rotem Schildhaupt in
Silber (Weiß) eine fünfendige schwarze Hirschstange. Die
schwarze Hirschstange, Symbol der Herrschaft Württembergs,
erinnert an die Zugehörigkeit Göppingens zum "Staate
Beutelsbach". Lange Zeit ging man davon aus, dass unmittelbar
nach dem Ende der "Stauferzeit" mit der Hinrichtung Konradins
in Neapel im Jahr 1268 die Herrschaft Württemberg im Raum
Göppingen die politisch tonangebende Kraft wurde. Die jüngsten
Forschungen des Göppinger Kreisarchivars Walter Ziegler
widerlegen diese Einschätzung nachhaltig. Er kommt zum
Ergebnis, dass das Haus Württemberg nicht im 13. sondern erst
im 14. Jahrhundert in Göppingen herrschaftspolitisch Fuß
gefasst hat. Dieses Fazit deckt sich mit dem Wappenbefund: das
württembergische Hirschstangenwappen lässt sich in der
archivalischen Überlieferung Göppingens erst für die Mitte des
14. Jahrhunderts belegen.

Das
württembergische Wappen in der Decke des kleinen Sitzungssaals
im Göppinger Rathaus
1348/49: Pestepidemie und Judenverfolgung
Auch heute noch
bedrohen die Menschheit große Seuchen - zum Beispiel AIDS. Im
Mittelalter war die Pest eine Geißel der Menschheit, die das
große Sterben brachte. Sie breitete sich von Zentralasien
kommend zwischen 1347 und 1352 über ganz Europa aus. Heute
schätzt man die Zahl der Opfer dieser Pestepidemie auf rund 20
Millionen Menschen, rund ein Drittel der damaligen
Bevölkerung. Viele sahen in der Krankheit, der man ohne
wirksame Heilmittel hilflos gegenüber stand, eine Strafe
Gottes für die Sünden der Menschheit. Es kursierten aber auch
Gerüchte, Juden hätten Quellen und Brunnen vergiftet und so
das Unglück herbeigeführt. Der jüdischen Minderheit war rasch
die Rolle des Sündenbocks zugedacht: die Mitglieder der
jüdischen Gemeinden wurden deshalb vielerorts auf schlimmste
Weise verfolgt. Auch die mittelalterliche jüdische Gemeinde
Göppingens wurde in Folge der pogromartigen Stimmung um die
Jahreswende 1348/49 ausgelöscht - so berichtet es das sog.
Memorbuch der jüdischen Gemeinde Deutz bei Köln, in dem die
"Marterstätten zur Zeit des Schwarzen Todes" aufgelistet sind.
Wie groß die Zahl der ermordeten Juden damals war und wie
viele Tote die Pest in der Stadt forderte, ist nicht
bekannt.

Rund 250 Jahre später, 1597, hielt die
Pest wieder in Göppingen Einkehr. Diesmal fielen ihr über 1000
Menschen, etwa die Hälfte der Einwohnerschaft, zum
Opfer.
1396: Göppinger Geld
Kaiser Karl IV.
verlieh dem württembergischen Grafen Eberhard II. im Jahr 1374
das Recht, unter seinem "gepreg und zeichen" eine Hellermünze
zu schlagen, die ihren Namen nach der Stadt Schwäbisch Hall
trug. Im Kirchheimer Münzvertrag vom 23. November 1396 hatte
Graf Eberhard III. von Württemberg dann für ein größeres
Gebiet eine Münzordnung für Heller und Schillinge erlassen, in
der Stuttgart und Göppingen als Prägeorte benannt sind. Die
hier geschlagenen "Göppinger Heller" – Schillinge wurden in
Göppingen nicht geschlagen – sind kleine Silbermünzen in der
Größe eines 20-Cent-Stücks. Sie erkennt man an den zwei
übereinanderliegenden Hirschstangen. Bereits 1404 verlor
Göppingen den Status einer Münzstätte wieder, indem in einem
neuen Münzvertrag die Standorte zur Münzprägung für ein
nochmals größeres Territorium völlig neu bestimmt
wurden.

1397: Der erste "niedergelassene" Arzt
Der erste in
Göppingen nachgewiesene Medicus war der in Gmünd geborene
Nicolaus von Schwert. 1397 tritt er als Zeuge in einer
Göppinger Urkunde auf. Von Schwert war auch Leibarzt von Graf
Eberhard III. von Württemberg. Dieser wollte an einem seiner
wichtigen Aufenthaltsorte – der Sauerbrunnen war damals sehr
geschätzt – einen sachkundigen Arzt zu seiner Betreuung haben.
Dass dieser noch seltene Berufsstand sehr gefragt war, lässt
sich daran ablesen, dass von Schwert für seine umfangreichen
Besitzungen keine Steuern bezahlen musste. Erst ab dem 14.
Jahrhundert gab es in Deutschland eine medizinische
Hochschule. Ansonsten übernahmen vor allem die Bader die
Aufgaben der Krankenversorgung: sie zogen Zähne, operierten,
ließen zur Ader und "verschrieben" Arzneien.
1397: Lateinschule
In dem reichhaltigen
Urkundenbestand des Hauptstaatsarchivs Stuttgart befindet sich
eine am 25. Juli 1397 ausgestellte Pergamenturkunde. Dieses
Dokument berichtet davon, dass der in Ulm beheimatete Paul
Botter und seine aus Göppingen stammende Frau Agnes eine
Stiftung zum Totengedenken auf den Jodok-Altar in der Kirche
St. Maria und Johannes der Täufer in Göppingen vollzogen
haben. Bei dieser Kirche handelt es sich um den Vorgängerbau
der heutigen Oberhofenkirche. Im Urkundentext ist beiläufig
von einem "rector puerorum", einem lateinischen Schulmeister,
die Rede. Dieser Hinweis ist der erste schriftliche Beleg
dafür, dass in der Stadt Latein unterrichtet wurde, ohne das
ein Studium an einer Hochschule unmöglich war. Dieser Notiz
zufolge besaß Göppingen also eine der ältesten Lateinschulen
im württembergischen Raum.
Zu ihren namhaftesten
Schülern zählen der Mathematiker Michael Mästlin, der Theosoph
Friedrich Christoph Oetinger und der Schriftsteller Hermann
Hesse. Nach dem Stadtbrand 1762 wurde die Lateinschule im
Gebäude an der Ecke Schul-/Pfarrstraße
eingerichtet.

Ein Rute
schwingender Lehrer sitzt vor seinen Schülern.
"seit altersher": Blaidlenge, Hoaraffe und
Sauerkrüagle
Früher gab es für die
Bewohner eines Ortes mindestens einen Necknamen.
Die Göppinger waren
bekannt als die Blaidlenge (die Blöden). So wurden sie
beispielsweise von den Geislingern genannt. Daraus spricht
auch der alte Gegensatz zwischen dem ehemals ulmischen
Geislingen und der württembergischen Grenzstadt
Göppingen.
Die Hohenstaufener
wurden als Hoaraffe (Hornaffen) bezeichnet. Dies kommt von den
Schlitten mit großen aufwärts gebogenen Hörnern, die die
Hohenstaufener Bauern früher im Winter benutzt
haben.
Weitere Beispiele
seien genannt: Die Göppinger waren auch die Sauerkrüagle, die
Bartenbacher die Spoallompe, die Faurndauer die
Wasseramsle.
Solche Necknamen sind
in einer Zeit entstanden, als die Menschen noch in ihrer
Freizügigkeit beschränkt waren, sei es durch Verkehrsschranken
oder politische Grenzen. So bezeichneten die Bewohner eines
Ortes die Einwohner eines anderen, meist des Nachbarortes mit
einem oder mehreren Necknamen. Viele dieser Spottnamen sind im
Laufe der Zeit allerdings verloren gegangen.

Scherz-Postkarte auf die Göppinger aus den 1920er
Jahren